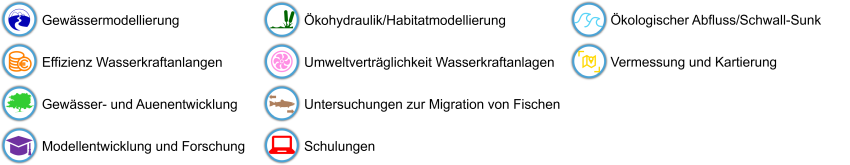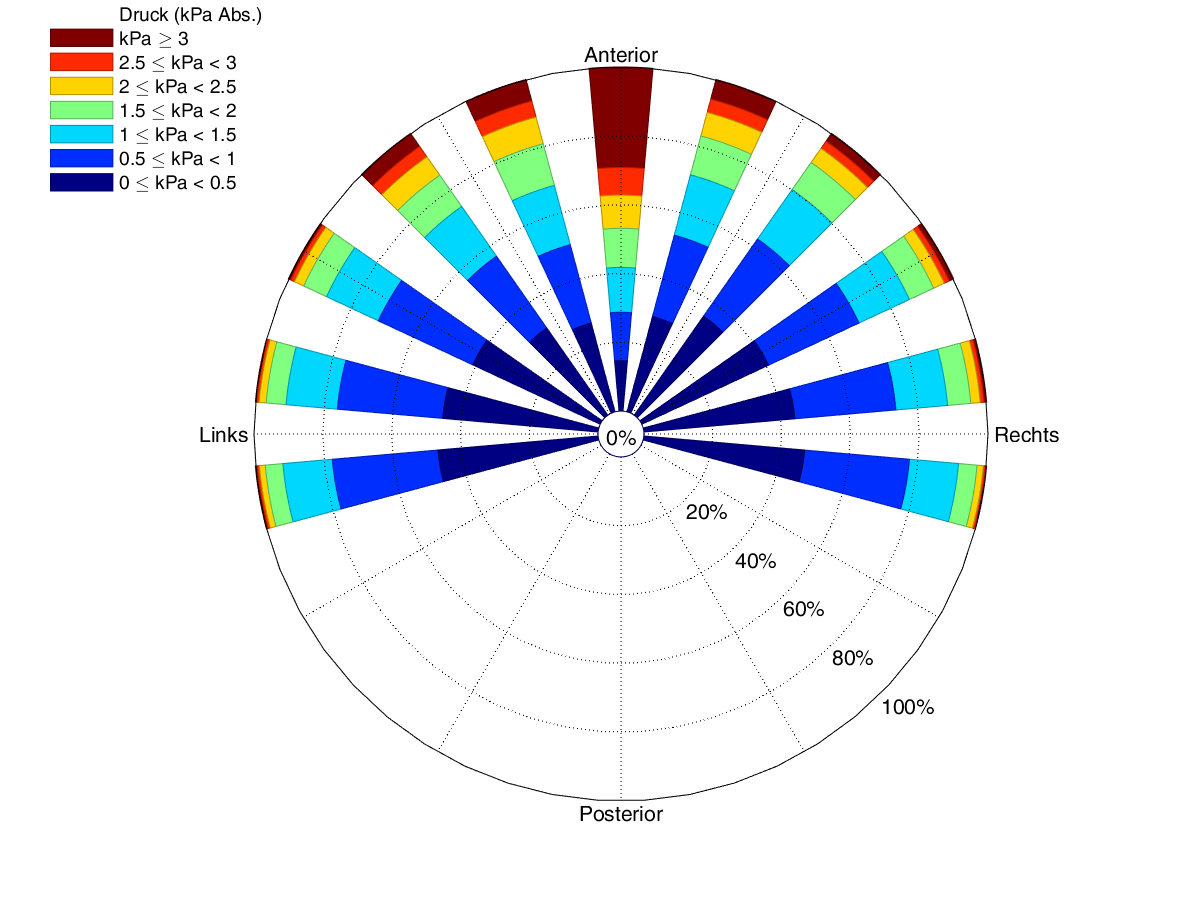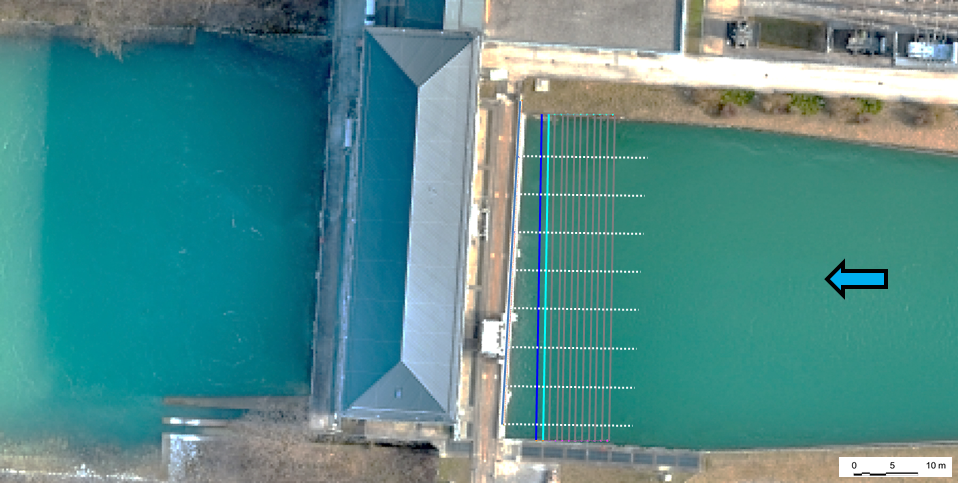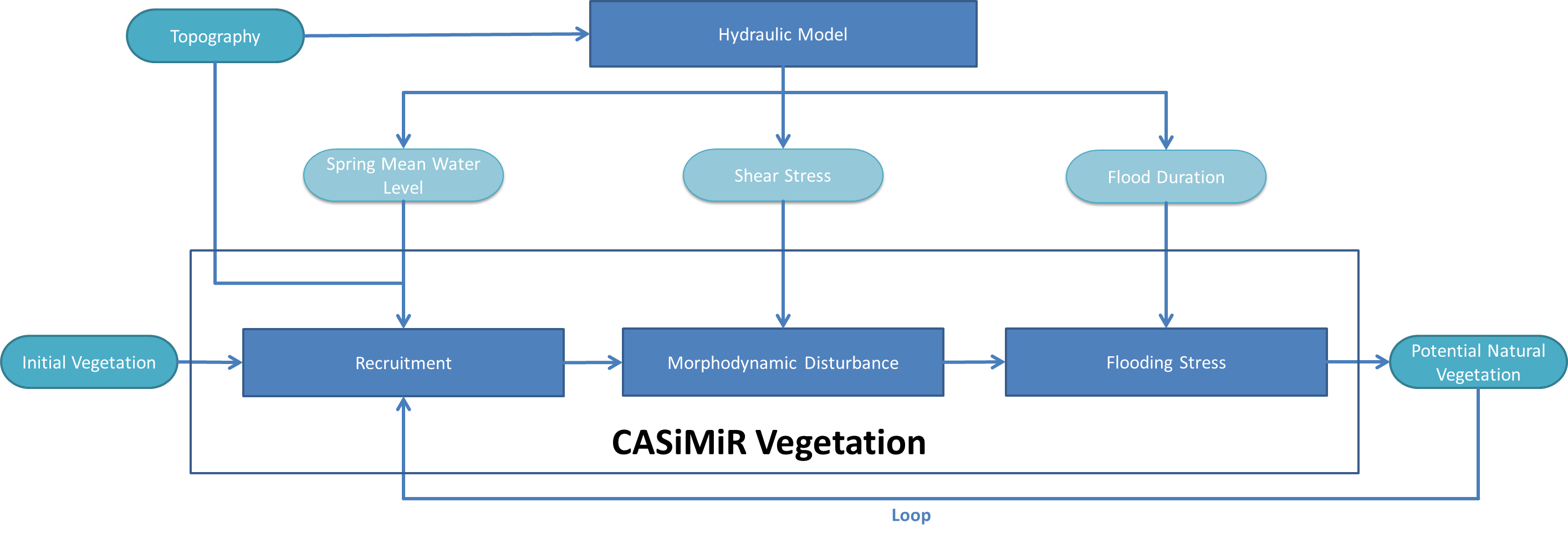HYDRO4U - Hydropower For You



Auftraggeber:
Europäische Kommission
Projektpartner:
Technische Universität München
Steinbeis-Europa-Zentrum
Universität für Bodenkultur Wien
Hydrosolutions GmbH
International Water Management Institute
Global Hydro Energy GmbH
Toshkent Irrigasiya va Qishlog Xojaligini Mexanizatsiaylash Muhandislari Instituti
Fundacion CARTIF
Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Kyrgyz State Technical University
Gesellschaft für Planung, Maschinen- und Mühlenbau Erhard MUHR mbH
ILF Consulting Engineers Austria GmbH
Projekthintergrund:
Die in Zentralasien gelegenen Länder Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan bergen ein riesiges Potential für die Erzeugung von Strom durch Wasserkraft. Die Qualität von in Europa entwickelter Wasserkraft-Technologie ist weltweit anerkannt. Aufgrund der hohen Kosten – im Vergleich zu asiatischen Mitbewerbern – werden Projekte im asiatischen Raum jedoch meist an nicht-europäische Unternehmen vergeben. Entsprechend werden Wasserkraftanlagen nicht immer in Einklang mit einer nachhaltig definierten ökonomischen und ökologischen Zielsetzung betrieben.
Projektbeschreibung:
Im Projekt HYDRO4U wird in einem internationalen Konsortium, bestehend aus Partnern aus der EU und aus Zentralasien, interdisziplinär gearbeitet. Erklärtes Ziel ist es, mit europäischer Technologie, eine auf Standorte in Zentralasien angepasste, nachhaltige und resiliente Wasserkraft – auf dem aktuellen Stand der Technik - zu entwickeln. Dabei werden an einzelnen Standorten in der Region Wasserkraftanlagen geplant und gebaut, wobei Rechtsvorschriften ähnlich der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und der Erneuerbaren-Energie-Richtlinie der EU Berücksichtigung finden. Das Video rechts zeigt den Aufbau eines Schachtkraftwerks wie es auch an einem Standort in Zentralasien umgesetzt werden soll.